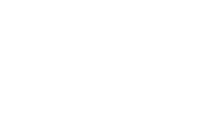Global Change

Der Globale Wandel ist eine der großen Herausforderungen unsere Zeit und umfasst als ein vom Menschen in Gang gesetztes Prozessgefüge sowohl gesellschaftliche als auch ökologische Aspekte. Aus systematischen Gründen wird er oft in Teilbereiche wie Bevölkerungsentwicklung, Biodiversität, Urbanisierung, Klimawandel, Landschaftsdegradation etc. untergliedert, der neben den ökologischen Prozessgefügen v.a. von Machtausübung, der Verfügbarkeit von Kapital, Ressourcenkonflikten und kritischen Mensch-Umwelt Verhältnissen geprägt ist.
Der Globale Wandel wird am Standort Freiburg als übergreifende, integratives „Schnittmengenthema“ zwischen Physischer Geographie und Humangeographie verstanden. In der konkreten Umsetzung wird er dabei aus verschiedenen Perspektiven behandelt und interpretiert.
Schwerpunkte sind der Klimawandel und seine gesellschaftliche Kontextualisierung über Klimavulnerabilität und Klimaanpassung auf der Grundlage eines umfassenden Prozessverständnisses, die Skalen bezogene transdisziplinäre Mensch-Umwelt Forschung und „Regional Studies“, worunter die zeitgemäße integrative Analyse von regionalen Schwerpunkten, etwa Nordamerika, verstanden wird. Die gesellschaftlichen Dimensionen und politischen Aushandlungsprozesse bezüglich des Globalen Wandels werden auch im Zusammenhang mit anderen globalen Trends, wie Urbanisierung, demographischem Wandel, sozialer Ungleichheit sowie ökonomischen und geopolitischen Transformationen untersucht.
Projekte mit Bezug zu Global Change
- Prozessschema für lokalspezifische Hitzeanpassung in kleinen Kommunen (PROLOK)ProjektleitungFünfgeld H, (Projektleitung), Pinto J G (Teilprojektleitung), Lorenz S, Fila D, (Team)Laufzeit01.04.2024 bis 31.03.2025BeschreibungEntwicklung eines Prozessschemas zum Aufbau von Kapazitäten zum präventiven und innovativen Umgang mit Hitzegefährdung als Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung mit Fokus auf kleine Kommunen. (Vorgängerprojekt: Lokale Kompetenzentwicklung zur Klimawandelanpassung in kleinen und mittleren Kommunen und Landkreisen (LoKlim))AnsprechpartnerFünfgeld H
Email: hartmut.fuenfgeld@geographie.uni-freiburg.deFinanzierungBaden-Württemberg. Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst - Adaptation capacity and action: Sub-national government responses to climate change actionProjektleitungFünfgeld H, (Projektleitung), Rickards L (Teilprojektleitung)Laufzeit01.02.2024 bis 31.12.2025BeschreibungAustralia and Germany are already experiencing serious climate change impacts. In Australia, recent disasters include devastating bushfires in 2019-20 and recurrent flooding in 2021-22. In Germany, recent dryness, drought periods and heat waves have harmed agriculture/forestry, while lethal extreme rainfall events in 2021 in the Ahrtal region destroyed whole communities. The IPCC documents the escalating climate change risks each country faces in coming decades, including the risks of cascading infrastructural breakdown and institutional overwhelm. As climate change adaptation is an urgent government imperative, this project provides a much-needed window into the ‘black box’ of institutional adaptation decision-making in two regions that share seemingly high adaptive capacity but slow adaptation action: Baden-Württemberg, Germany, and Victoria, Australia. The aim is to foster more effective and just public sector adaptation by analysing how and why officials are approaching adaptation the way they are. The research questions are: 1. In Baden-Württemberg and Victoria’s state governments, which groups are working on climate change adaptation and why? 2. What are their professional/disciplinary lenses and how do these shape the risks they prioritise, and the adaptation approaches they favour? How do they perceive cascading, compounding and catastrophic climate change risks? 3. How do work settings affect their perspectives and actions? What role do national differences play? 4. What does this suggest about ‘institutional barriers’ to effective and just adaptation and how these can be overcome? What positive ideas can be gleaned from diverse contexts?AnsprechpartnerFünfgeld H
Email: hartmut.fuenfgeld@geographie.uni-freiburg.deFinanzierungDeutschland. Bundesministerium für Bildung und Forschung - Clim`Ability Care – Transformation von Gewerbegebieten und Industrieclustern angesichts des Klimawandels: Für eine neue transnationale Unternehmenskultur am OberrheinProjektleitungGlaser RLaufzeit01.05.2023 bis 30.04.2026BeschreibungDie Oberrheinregion ist besonders stark von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen. Hitze- und Dürrewellen, Schwüle, Tropennächte, aber auch Überschwemmungen und Stürme sowie schlechte Luftqualität wirken sich auf Mensch und Umwelt und insbesondere auch auf kleine und mittlere Unternehmen sowie die eingebundenen Akteure im Arbeitsalltag aus. In dem transnationalen Forschungsvorhaben Clim’Ability Care arbeiten mehrere Forschungseinrichtungen daran, wie mit den Herausforderungen des Klimawandels umgegangen werden kann. Dabei kann auf die Erkenntnisse der Vorgängerprojekte Clim'Ability und Clim'Ability Design aufgebaut werden. In der neuen Projektphase Clim’Ability Care liegt der Fokus auf der Förderung und Ableitung einer neuen klimaresilienten Unternehmenskultur. Die zentrale Frage dabei ist, wie die Dimensionen Warnung, Abschwächung, Anpassung und Versorgung eingebunden werden können. Die konkreten Ziele sind: (1) Auswahl von Standorten, die aufgrund ihrer klimatischen und sozioökonomischen Ausstattung eine besondere Sensibilität gegenüber Klimaänderungen aufweisen (2) Aktualisierung und Erweiterung der Toolbox "Clim'Ability", in der die klimatischen Stressoren und die daraus resultierende Betroffenheit, aber auch Anpassungsstrategien online verfügbar sind (3) Förderung einer oberrheinweiten neuen Unternehmenskultur durch „Lernsituationen“ (4) Institutionalisierung durch die Schaffung einer neuen grenzüberschreitenden Unternehmens- und Risikokultur (5) Kommunikation, Verbreitung und Sichtbarkeit des Projekts Die Zusammenarbeit zwischen regionalen Hochschulen, öffentlichen Einrichtungen und KMUs fördert Synergien zwischen verschiedenen lokalen, disziplinären und wirtschaftlichen Kulturen. Parallel werden im Projekt die institutionellen und wirtschaftlichen Modelle und Konzepte im Hinblick auf die Nachhaltigkeit der territorialen Klimadienstleistungen im südlichen Oberrhein untersucht.AnsprechpartnerGruner SFinanzierungEU-INTERREG VI
- Entschlüsselung des fluvio-sozialen Metabolismus am Oberrhein - Faktoren und Akteure bei der Transformation zu einer fluvialen Anthroposphäre vor der IndustrialisierungProjektleitungBlöthe J, Glaser R, Preusser F, Schenk GLaufzeit01.04.2023 bis 31.03.2026BeschreibungLängst verändert der menschliche Einfluss die natürliche Entwicklung von Auen. Während die Auswirkungen der Entwaldung auf Sedimenttransport und Auendynamik in vielen Studien adressiert wurden, sind die sozio-ökologischen Prozesse und Rückkopplungsmechanismen, die bestimmen, wie sich fluviale Systeme entlang von Trajektorien und Pfadabhängigkeiten entwickeln, erst seit kurzem Gegenstand der wissenschaftlichen Debatte. Hier verwenden wir das Konzept des fluvio-sozialen Metabolismus, um diese komplexen Wechselwirkungen zwischen anthropogenen und natürlichen Prozessen zu veranschaulichen, die den Übergang natürlicher Flusssysteme in eine fluviale Anthroposphäre bestimmen. Ziel des Projekts ist es, den fluvio-sozialen Metabolismus entlang von Pfadabhängigkeiten und Trajektorien zu entschlüsseln und die Systemdynamik der fluvialen Anthroposphäre im Oberrheingebiet zu verstehen. Wir konzentrieren uns auf drei spezifische Aspekte und ihre gegenseitigen Abhängigkeiten: sozio-politische Systeme, Klimadynamik und anthropogen konditionierte Sedimente. Hierfür integrieren wir Sozial- und Umweltarchive sowie Labor- und geostatistische Analysen. Durch die Kombination quantitativer, semi-quantitativer und qualitativer Methoden verbinden wir sozial- und naturwissenschaftliche Erkenntnisse. Wir versuchen, integrierende Indikatoren für den Übergang von natürlichen Flussauen zu einer fluvialen Anthroposphäre auf verschiedenen räumlichen und zeitlichen Skalen zu identifizieren. Unsere Forschung analysiert den Zeitraum vom Mittelalter bis zum Beginn der industriellen Revolution in der Region um 1850 mit Schwerpunkt auf vermuteten Übergangszeiten. Wir verfolgen die Hypothese, dass in diesem fluvio-sozialen System spezifische sozio-natürliche und politische Konstellationen, einschließlich territorialer Verschiebungen, wirtschaftlicher Ausbeutung, Institutionen, Konflikten, klimatischer Variabilität und Extremereignissen sowie Hochwasserereignissen, Pfadabhängigkeiten und Trajektorien der fluvialen Landschaftsentwicklung bestimmten, die ihren Ausdruck in den Flussauen als anthropogene Sedimente finden. Wir verfolgen einen multidisziplinären Ansatz, der verschiedene Disziplinen integriert und historische, klimatische und geomorphologische Ergebnisse kombiniert. In drei miteinander verknüpften Arbeitspaketen untersuchen wir, wie 1) Akteure, sozio-politische Konstellationen und Institutionen die Auenentwicklung beeinflussten, 2) regionale Klimavariabilität und Extremereignisse sozio-ökologische Prozesse bestimmten und 3) natürliche und gesellschaftliche Dynamiken ihren Ausdruck in den Sedimenten der Flussauen fanden. Durch die Synthese dieser sozialen, klimatologischen und geomorphologischen Ergebnisse zielen wir darauf ab, den fluvio-sozialen Metabolismus zu entschlüsseln. Schließlich bewerten wir, inwieweit unsere Ergebnisse dazu beitragen können, diesen dynamischen fluvio-sozialen Metabolismus empirisch, numerisch und multivariat-statistisch zu modellieren.AnsprechpartnerBlöthe J
Tel.: 203-9224
Email: jan.bloethe@geographie.uni-freiburg.deFinanzierungDFG - Tracing Knowledge Politics of Natural Hazard Risk Management at a Local Level - A Case Study in the Entlebuch Region (Switzerland)ProjektleitungRudloff A, Fünfgeld HLaufzeit01.10.2022 bis 31.03.2026BeschreibungUnter dem Druck globaler gesellschaftlicher Herausforderungen, stellen zunehmende und sich intensivierende Risiken im Kontext von Naturgefahren eine erhebliche Herausforderung für viele Regionen in der Schweiz, darunter viele kleinere Berggemeinden, dar. In diesem Zusammenhang werden seit vielen Jahren u.a. Fortschritte in der Wissensproduktion und Risikokommunikation, um eine Akzeptanz von Maßnahmen des Risikomanagements zu erreichen angestrebt. Das zentrale Ziel dieses Projekt ist es, das Verständnis politischer Dimensionen von Wissensdynamiken im Naturgefahrenrisikomanagement zu erweitern und einen analytischen Rahmen für Untersuchungen von Gerechtigkeitsimplikationen zu entwickeln. Der empirische Fokus liegt dabei auf einer ländlichen Gemeinde in der Region Entlebuch (Kanton Luzern), dessen Entwicklung seit langem mit gesellschaftlichen Aushandlungen des Umgangs mit Naturgefahrepn verknüpft ist (z.B. Errichtung von Schutzbauten vor Murgängen, Einrichtung eines kommunalen Lawinendiensts). Anhand einer qualitativen Feldstudie werden ausgehend vom lokalen Kontext Prozesse und Kontexte der Wissensproduktion und -zirkulation und deren Wechselbeziehungen mit sozialen Prozessen der Raumproduktion skalenübergreifend analysiert. Konzeptionell bedient sich das Projekt Idee von socio-technical imaginaries (STI), um Verknüpfungen und Wechselwirkungen normativer, epistemischer und materieller Dimensionen des Risikomanagements zu untersuchen. Ausgehend von intensiven Auseinandersetzungen mit Alltagspraktiken und Deutungsmustern auf lokaler Ebene setzt der Beitrag historische und aktuelle raumbezogene Zukunftsvisionen in Bezug zu Aushandlungen des Umgangs mit Naturgefahren und damit einhergehenden Prozessen der Wissensproduktion und -zirkulation. Auf Grundlage von Interviews, informellen Gesprächen, Beobachtungen und Dokumentenanalysen auf lokaler, kantonaler und nationaler Ebene (z.B. mit Praktiker*innen, politischen Entscheidungsträger*innen, Wissenschaftler*innen, Anwohner*innen) wird der Frage nachgegangen, wie sich frühere und aktuelle Zukunftsvisionen (z.B. in Bezug auf die Entwicklung ländlicher Bergregionen oder die gesellschaftliche Bedeutung technischer Lösungen in Gesellschaft-Umwelt-Beziehungen) in Ausprägungen des Naturgefahrenrisikomanagements und damit zusammenhängenden Prozessen der Wissensproduktion und -zirkulation materialisieren. Dabei ist die Einordnung der jeweiligen Prozesse in skalenübergreifend wirksame sociotechnical imaginaries zentral.AnsprechpartnerRudloff A
Email: anna.rudloff@geographie.uni-freiburg.de - Community forestry and climate resilience - A global systematic reviewProjektleitungFeurer MLaufzeitseit 01.01.2022 (unbegrenzt)Beschreibung-
- Gardening the Urban Forest: A nature prescription pilot program to promote positive health and environmental behaviors among Freiburg residents: A mixed-methods, transdisciplinary approach to investigate health and well-being, nature-connectedness, and plant biodiversity in tree pit pocket gardens in Freiburg, GermanyProjektleitungScherer-Lorenzen M (Projektleitung), Baldwin Heid K (Projektleitung)Laufzeit01.01.2022 bis 31.12.2025BeschreibungThis is a transdisciplinary project involving two University of Freiburg departments (Geo-botany and Human Geography and Global Change), the University Clinic of Freiburg Institute of General Medicine, the city of Freiburg, and the Eco-station. The City of Freiburg’s “Freiburg Packt An (FPA)” street tree sponsorship program is the nature-based intervention prescribed by the general practitioner of the patient. This prescription (BRx) connects the patient to the researcher and the tree sponsorship program, which ensures access to the FPA coordinator and FPA-sponsored events as well as to education and materials – such as seeds and native plants – provided by the Eco-station in Freiburg. The target intervention group is broadly defined as any adult individual who lives in Freiburg and may be at risk of developing or deepening a non-communicable disease. The target control group consists of individuals who newly register for the Freiburg Packt an tree sponsorship program (independently and without a doctor’s prescription). All research methods and support will be the same for the intervention and the non-intervention groups.AnsprechpartnerBaldwin Heid K
Email: kelly.heid@biologie.uni-freiburg.de - Geographien der Umsiedlung im Kontext von Multiskalenprozessen der Umweltdegradation – eine Fallstudie küstennaher Umsiedlung im ghanaischen Volta River DeltaProjektleitungFünfgeld H, Neu F (Team)Laufzeit01.08.2020 bis 31.03.2025BeschreibungStaatlich angeleitete Umsiedlungsmaßnahmen traten in den letzten Jahrzehnten im Globalen Süden vermehrt als in Kauf zu nehmende Begleiterscheinung großer Staudammprojekte auf (vgl. Rogers/Wilmsen 2019). Doch inzwischen findet Umsiedlung auch als Reaktion auf durch den Klimawandel verstärkt auftretende Extremwetterereignisse statt (vgl. bspw. Arnall 2014). Auf globaler Ebene als besonders vulnerabel gelten niedrig gelegene Küstenregionen, die oftmals eine hohe Bevölkerungsdichte aufweisen und durch den weltweiten Meeresspiegelanstieg von Überschwemmung und Küstenerosion bedroht sind. In manchen Bereichen des Volta-Deltas im Südosten Ghanas wurde – ausgelöst durch eine Kombination aus Meeresspiegelanstieg und durch den Akosombo-Staudamm zurückgehaltene Sedimente – die Küstenlinie um bis zu drei Kilometer ins Landesinnere verlagert. Dadurch fielen ganze Dörfer der Erosion der Atlantikküste zum Opfer. Aus diesem Grund wurde von staatlicher Seite ab 2017 ein Umsiedlungsdorf für mehrere Hundert betroffene Haushalte auf einem künstlich aufgeschütteten Landstrich in der Lagune von Keta, östlich der Mündung des Volta-Flusses, errichtet. Bisher wurden Studien zu Umsiedlung hauptsächlich im Rahmen von Staudamm-Projekten durchgeführt, die allerdings oftmals lediglich auf eine Optimierung des Umsiedlungsprozesses abzielen. Auf dem Weg zu einer tiefergehenden, kritischen Auseinandersetzung mit Umsiedlung im Sinne einer Critical Geography of Resetttlement (vgl. Rogers/Wilmsen 2019) fehlt es an aktueller Forschung. Das Forschungsprojekt möchte einen Beitrag zu diesem neuen Forschungsfeld leisten und untersucht darum das oben beschriebene ghanaische Beispiel im Rahmen einer Fallstudie. Auf übergeordneter Ebene befasst es sich mit Geographien der Umsiedlung im Kontext von Multi-Skalen-Prozessen des Umweltwandels und der Umweltdegradation, welche aus dem Blickwinkel der Politischen Ökologie beleuchtet wird. Dabei bilden theoretische Konzepte wie Macht (u.a. Foucault), Gewalt (u.a. Watts, Nixon) und Gerechtigkeit (u.a. Rawls, Sen) die Grundlage des Analyserahmens. Das Forschungsprojekt legt den Fokus auf drei Schlüsselelemente innerhalb von Umsiedlungsprozessen: Akteure, Macht und Interessen. In Anknüpfung daran werden drei Forschungsfragen analysiert: 1) Wie verwend(et)en unterschiedliche Akteure ihre jeweilige Macht um den Umsiedlungsprozess auf eine Weise zu beeinflussen, die ihren eigenen oder Interessen bestimmter anderer Akteure dient(e)? 2) Wie und von wem wurde die Umsiedlung legitimiert? 3) Welche sozialen, politischen und ökonomischen Auswirkungen auf umgesiedelte Personen bestehen und wie können diese auf bestimmte Umsiedlungspraktiken zurückgeführt werden? Im Rahmen des Forschungsprojektes werden mehrere Feldforschungsaufenthalte durchgeführt. Der dabei angewandte Methodenkoffer setzt sich aus qualitativen und ethnographischen Forschungsmethoden der Geographie zusammen.AnsprechpartnerFriedrich Neu
Tel.: +49(0)761 203-54233
Email: friedrich.neu@geographie.uni-freiburg.deFinanzierung- Kurzstipendium für Doktorand*innen des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) zur Finanzierung der Feldforschung 2020 (nicht in Anspruch genommen wegen Reisebeschränkungen nach Ghana aufgrund von Covid-19), - Promotionsstipendium des Evangelischen Studienwerks Villigst, finanziert aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), inkl. Förderung von Feldforschung (01.08.2020 bis voraussichtlich 31.03.2025) - Suspensionsfracht in Deutschen WasserstraßenProjektleitungHoffmann Th, Blöthe JLaufzeitseit 01.10.2017 (unbegrenzt)BeschreibungIn Suspension transportierte Partikel dominieren den Sedimentfluss der größten Flusssysteme der Erde und stellen gleichzeitig ein wichtiges Transportmedium für Kontaminanten dar. Im Zuge der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie, die auf eine guten ökologischen und chemischen Zustand der Gewässer abzielt, kommt dem Verständnis der Dynamik von Suspensionsfracht somit eine entscheidende Bedeutung zu. Dabei sind die Quellen und Senken von Suspensionsfracht raum-zeitlich sehr variabel, was zu großen saisonalen und regionalen Unterschieden in der Schwebfracht führt. In diesem Projekt möchten wir das Zusammenspiel von Sedimentquellen, den Transportmechanismen und der Ablagerung von Schwebfracht in großen Flüssen der Deutschen Mittelgebirgs- und Tieflandsregionen genauer untersuchen. In einer ersten Studie untersuchen wir den Einfluss von organischen Schwebstoffen auf die Gesamtkonzentration und zeigen, wie sprunghafte Änderungen in der Skalierung von Suspensionsfracht und Abfluss mit dem organischen Schwebstoffanteil zusammenhängen.AnsprechpartnerHoffmann ThPublikationenOriginalarbeiten in wissenschaftlichen Fachzeitschriften
- Hoffmann T O, Baulig Y, Fischer H, Blöthe J H: Scale-breaks of suspended sediment rating in large rivers in Germany induced by organic matter Earth Surface Dynamics, 2020; 8: 661-678: https://doi.org/10.5194/esurf-2020-3